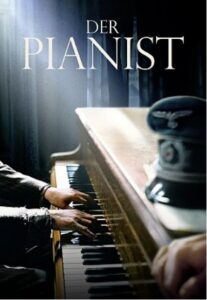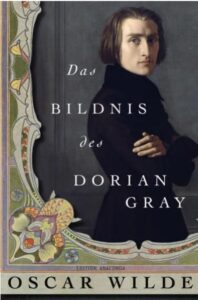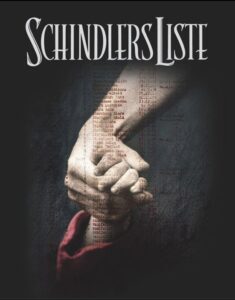„Im Westen nichts Neues“ von Erich Maria Remarque ist weit mehr als ein Kriegsroman – es ist ein eindringlicher Blick auf die Menschlichkeit inmitten der Grausamkeit und Sinnlosigkeit des Ersten Weltkriegs. Erzählt wird aus der Perspektive des jungen Soldaten Paul Bäumer, der zusammen mit seinen Klassenkameraden an die Front geschickt wird – voller patriotischer Ideale und einer vagen Vorstellung von Heldentum. Doch was sie dort erwartet, ist kein Abenteuer, sondern ein zutiefst verstörender Albtraum aus Dreck, Blut, Lärm und Verzweiflung.
Die einst spielerische Faszination, die der Krieg in vielen jungen Männern auslöste – genährt von Kindheitserinnerungen an Räuber-und-Polizist-Spiele und romantisierte Geschichten älterer Generationen – wird in Remarques Werk schonungslos entlarvt. Die Realität des Grabenkampfes vernichtet jede Illusion. Der Krieg ist keine Bühne für Helden, sondern ein Ort, an dem Individualität, Empathie und Zukunft ausgelöscht werden.
Der Roman konfrontiert Leserinnen und Leser mit der Frage: Warum zieht der Krieg immer wieder junge Menschen in seinen Bann – trotz all des Elends, das er hinterlässt? Die Verwandlung der Jugend in zerstörte Seelen wirkt wie ein stummer Schrei gegen eine Welt, die aus der Geschichte nichts gelernt hat. Wie kann es sein, dass wir als Menschheit – nach all dem Leid und nach Remarques unvergesslichen Worten – den Krieg noch immer nicht überwunden haben? Vielleicht ist gerade das die tragischste Lehre des Buches: dass es nicht an Erkenntnis fehlt, sondern an Konsequenz.
Das Buch wurde bisher dreimal verfilmt. Ich habe selbst nur die letzte Verfilmung gesehen. Es ist die erste deutsche Verfilmung, inszeniert von Edward Berger. Diese Version wurde international gefeiert, gewann vier Oscars (u. a. für den besten internationalen Film) und wurde von Netflix produziert. Der Film gibt für mich, ohne übertrieben brutal und effekthascherisch zu sein, die Stimmung des Buches sehr gut wieder. Er zeigt in eindrücklichen Bildern das unsagbare Leid aller Menschen, die von einem solchen Krieg betroffen sind. Das war damals so – und es ist heute nicht anders.
Aber ganz besonders beeindruckt hat mich der Hauptdarsteller: Felix Kammerer, ein österreichischer Schauspieler, der mit dieser Rolle sein Kinodebüt gab.
Was ihn so besonders macht? Felix Kammerer verkörpert Paul Bäumer mit einer stillen Intensität, die tief unter die Haut geht. Er spielt keinen klassischen Helden, sondern einen jungen Mann, der vom Krieg überrollt wird. Genau das macht seine Darstellung so eindringlich. Seine körperliche und emotionale Hingabe an die Rolle war aussergewöhnlich: monatelanges Training, Sprachcoaching, das Studium historischer Quellen und eine fast dokumentarische Präsenz vor der Kamera. Ihm gelingt es, mit minimalem Ausdruck maximale Wirkung zu erzielen. Sein Blick allein erzählt von Angst, Verlorenheit und der schleichenden Entmenschlichung. Gerade weil er vor diesem Film kaum bekannt war, wirkt seine Figur umso authentischer. Nicht wie ein Schauspieler in Uniform, sondern wie ein echter Mensch im Ausnahmezustand.
Ich wünschte mir, dass jede Generation dieses Buch oder diesen Film wieder neu für sich entdeckt, um zu verstehen, was wir Menschen einander antun – und dass wir endlich anfangen, daraus zu lernen.
Hier kannst Du den Trailer zum Film sehen: